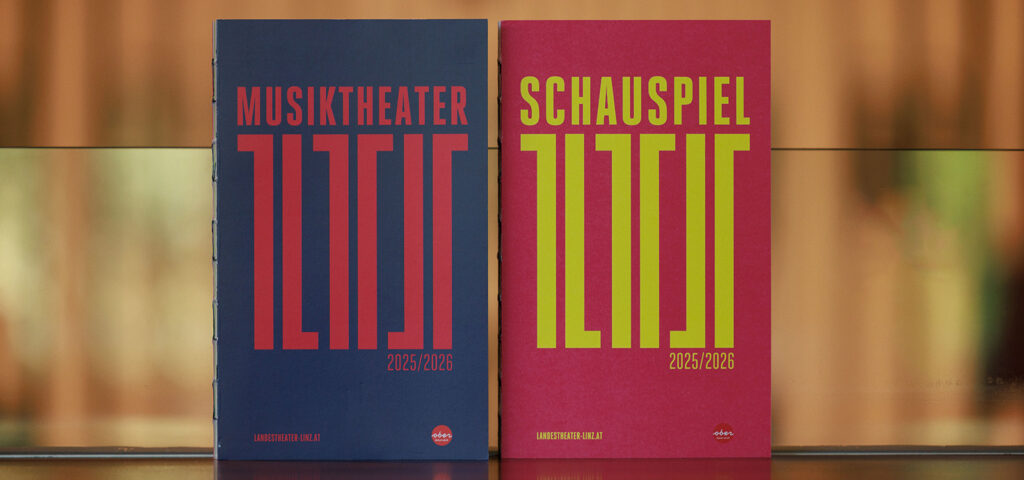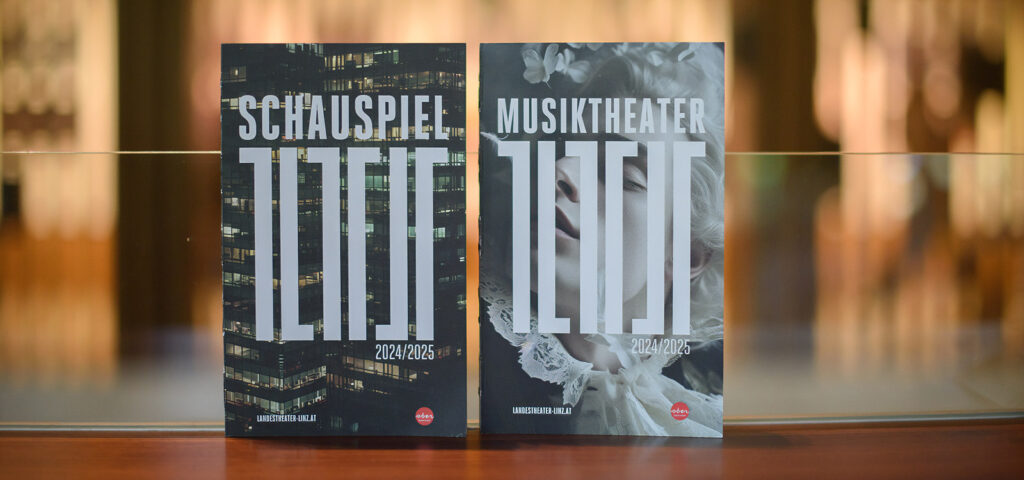Olga Flor plädiert für eine Politik der Fakten. Derzeit allerdings, so bedauert die Autorin, schürten die Verantwortlichen gezielt negative Gefühle in der Bevölkerung. Sie beobachtet eine Strategie der Ablenkung, der Scheinlösungen und der gezielten Suche nach Sündenböcken. Ihre Strategie als Privatperson: Wachsam bleiben und den Humor nicht verlieren.
Frau Flor, Sie sind Mit-Initiatorin des Aufrufs, in dem das Nein der Bundesregierung zum UNO-Migrationspakt als „Schande“ und „Schritt in die internationale Isolation“ kritisiert wird. Haben Sie den Eindruck, dass KünstlerInnen vermehrt politisch aktiv werden?
Vielleicht. Denn es steht unser Demokratiemodell auf dem Spiel. Die Abkehr der Bundesregierung vom Migrationspakt hat Gerhard Ruiss (Anm.: Schriftsteller, Vorstandsmitglied der IG Autorinnen, Autoren) und mich sehr empört. So haben wir diesen Aufruf gestartet, der sofort sehr viel und sehr prominente Unterstützung fand. Ich denke, diese Entscheidung hat die ÖVP wieder ein Stück weit von ihrer bürgerlichen Gesinnung entfernt. Der Migrationspakt ist die Absichtserklärung eines gemeinsamen Handelns, aus der Einsicht entstanden, dass globale Probleme nur auf einer globalen Ebene gelöst werden können. Er ist ein Symbol für ein weltweites Miteinander anstelle des Spiels mit nationalistischer Abschottung, die eine Illusion ist, und eine höchst gefährliche noch dazu.
In Ihrem kürzlich erschienenen Essay Politik der Emotion stellen Sie fest, dass Politik derzeit zu Gefühlen anregt, die nicht zu den positiven zählen. Welche Gefühle meinen Sie da in erster Linie?
Es werden negative Emotionen wie Neid oder Wut geweckt, um daraus Kapital zu schlagen, Aufmerksamkeit zu generieren. Ohne Flüchtlinge gibt es kein ausschlachtbares Thema mehr. Ich beobachte auch eine gezielte Ablenkung durch die – durchaus sehr versierte – Medienpolitik der Bundesregierung. Ungefähr einmal wöchentlich wird ein Thema zur Diskussion gestellt, kürzlich war es das Kopftuchverbot, Stimmungen werden auf diese Weise geschürt, damit werden aber dringliche Themen wie etwa die neuen arbeitsrechtlichen Bestimmungen in der öffentlichen Debatte in den Hintergrund gedrängt. Scheinlösungen werden angeboten, Sündenböcke gesucht.
Meinen Sie, dass die Mobilisierung positiver Gefühle weniger zielführend für die PolitikerInnen wäre?
Ja, durchaus. Dass sich etwa Solidarität und Mitgefühl nicht zwangsläufig positiv auf die verantwortlichen Politiker auswirken müssen, war kürzlich bei jenem Vorfall in Vorarlberg zu sehen, als Sebastian Kurz in Bregenz von einigen empörten BesucherInnen lautstark bezüglich einer umstrittenen Abschiebung zur Rede gestellt wurde. In Vorarlberg haben sich Gemeinden für die Flüchtlinge eingesetzt. Diese empathischen Gefühle sind allerdings nicht so angenehm für die verantwortlichen Politiker, denn sie konterkarieren ihre Deutung der Vorgänge, lohnender scheint es, negative zu wecken. Denn Kompromisse einzugehen wird wohl als verkaufstechnisch nicht so sexy betrachtet.