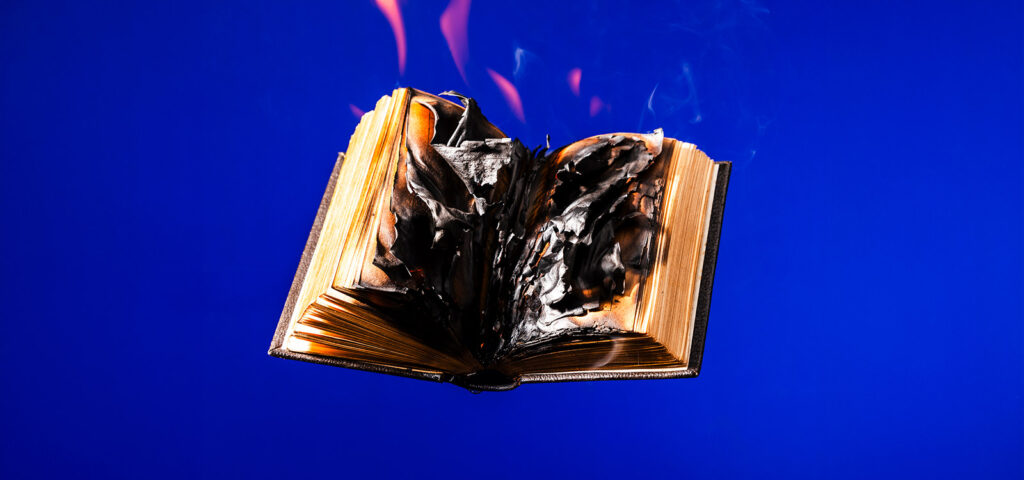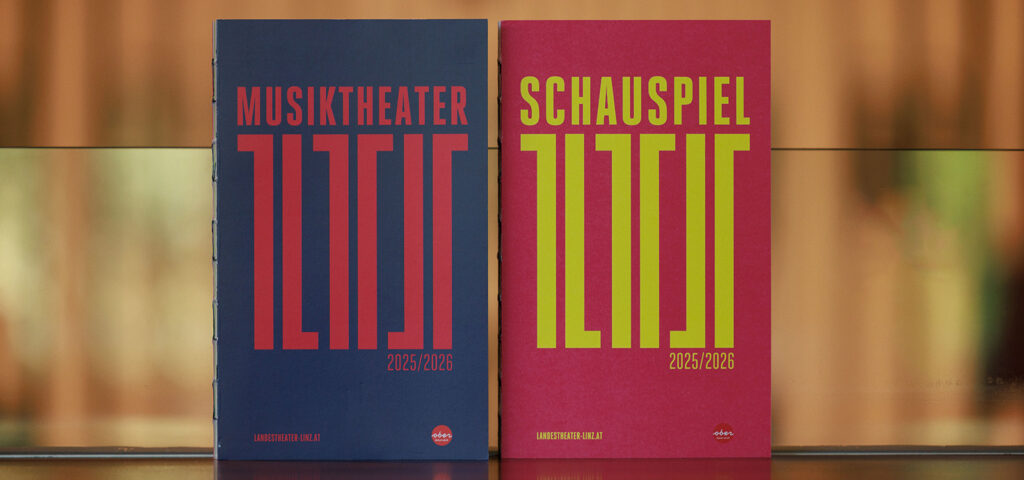Und wenn man als deutsche Dramaturgin beispielsweise die letzte Johann Strauss-Operette Wiener Blut betreut, wird klar, dass die Fähigkeit, übereinander, aber vor allem auch über sich selbst lachen zu können, elementar wird. Man darf beispielsweise weder die Herkunft noch das Portrait des sächsischen Fürsten Ypsheim-Gindelbach, Premierminister von Reuß-Schleiz-Greiz, allzu eng sehen. Die Tatsache, dass Greiz in Thüringen liegt – geschenkt. Die Tatsache, dass der Premierminister sich schwer tut mit dem Dialekt (und daher auch mit allem Zwischenmenschlichen) – halb so wild, das macht ihn sympathisch-skurril. Die Tatsache, dass er keine Ahnung zu haben scheint von der Welt – die beste Grundlage für eine absurde Operette, die persönlich und zugleich hochpolitisch ist und vor allem auch von Vorurteilen übereinander erzählt.
Weltoffen
Dabei war Sachsen zur Zeit des Wiener Kongresses 1814/1815 keineswegs provinziell und war es auch in den Jahrhunderten davor nicht – nicht nach damaligem und eigentlich auch nicht nach heutigem Verständnis. Unter Herrschern wie August dem Starken war das Kurfürstentum zu einem florierenden Staat geworden, der beispielsweise den Ruf von Dresden als Metropole begründete, aber auch die Position von Leipzig als weltoffene Messestadt postulierte, die in Verbindung auch mit den entferntesten Kulturen stand. Zwar war Sachsen als Staat zu dieser Zeit nicht ganz zu vergleichen mit einer tatsächlichen Weltstadt wie Wien. Aber: Die Gemeinsamkeiten sind doch leicht zu finden.
Hauptsache Kaffee!
Denn wenn Fürst Ypsheim-Gindelbach in Wiener Blut vor lauter Stress über die für ihn fremde Stadt und seine Bewohner:innen, die er einfach nicht zu verstehen scheint, einen „Blümchenkaffee“ bestellen will, dann bestellt er nicht nur einen besonders dünn aufgebrühten Kaffee (so dünn, dass man durch ihn das Blumenmuster des Meißner Porzellans sehen konnte), sondern er bedient auch das (vor allem in Deutschland) zur Zeit der Entstehung der Operette äußerst populäre Klischee des „Kaffeesachsen“. Denn ja, die Idee, dass die Bürger:innen Sachsens, beginnend schon zur Zeit von August dem Starken, eine immense Liebe für Bohnenkaffee haben, die bis heute anhält, ist ein herrliches Klischee, das viel mit einer gewissen Gleichzeitigkeit von Gemütlichkeit und Weltläufigkeit zu tun hat. Kaffee als liebstes Getränk der Sachsen? Das scheint nahezuliegen.
Nicht nur, dass etwa Melitta Bentz, die Erfinderin des Kaffeefilters (das Patent wurde ihr 1908 erteilt) aus Dresden stammte, oder 1697 die erste Deutsche Kaffeeordnung in Leipzig erlassen wurde, und dass – wichtig für den Blümchenkaffee in Porzellantassen – ab ungefähr 1710 zunächst in Dresden, später im nahegelegenen Meißen das erste europäische Porzellan hergestellt wurde. In Leipzig steht mit dem „Zum Arabischen Coffe Baum“ eines der ältesten Kaffeehäuser Europas, das seit 1711 als solches dient und auch heute noch geöffnet ist. Mindestens so legendär wie „Auerbachs Keller“ ist dieses Kaffeehaus der Ort, an dem sich neben dem schon genannten August dem Starken auch etwa Johann Sebastian Bach (nicht umsonst ist er der Komponist der Kantate Schweigt stille, plaudert nicht, BWV 211, besser bekannt als Kaffeekantate), Gotthold Ephraim Lessing oder auch Paul Lincke und Erich Kästner in Leipzig ihren Kaffee gönnten. Im Idealfall gab es dazu sächsische Mehlspeisen wie Leipziger Lerchen (ein Mürbteiggebäck, das mit Marzipan und Marmelade gefüllt wird) oder Eierschecke (ein Hefeteig, auf dem Pudding und Topfen mit Rosinen gebacken werden). Und spätestens da wird doch klar: Kulinarisch sind die Freuden in Österreich und Sachsen gar nicht so weit voneinander entfernt wie gedacht. Denn die Liebe zu Kaffee und Mehlspeise kommt uns hierzulande sehr bekannt vor. Insbesondere die Wiener Kaffeehauskultur ist Teil eines Bildes über Österreich und seine Bewohner:innen, das genauso einen der schönen Stereotypen meint, wie der „Kaffeesachse“ es kann – mit dem Unterschied, dass die Wiener Kaffeehauskultur seit 2011 sogar zum immateriellen Weltkulturerbe der Unesco gehört und zu Recht bis in die Gegenwart eine besondere Anziehung nicht nur auf Tourist:innen ausübt. Aber: Die Liebe zur Gemeinschaft über eine Tasse Kaffee verband wohl schon zur Zeit des Wiener Kongresses zwei Staaten, die sich sonst oft fremd geblieben sein durften. Vermutlich lacht es sich auch deshalb so gut übereinander und vor allem miteinander: Das Erkennen der eigenen Skurrilitäten im anderen, da man vielleicht die gleichen Dinge schätzt – egal ob schrullig oder nicht, egal ob der Kaffee stark ist oder eher schwach. Hauptsache Kaffee.