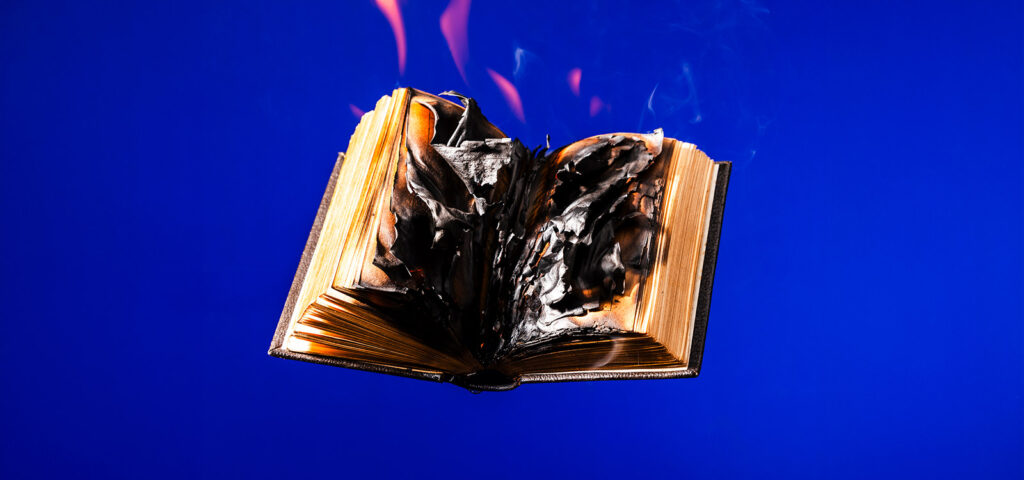Von nicht geringem Interesse ist allerdings auch, wie ein Werk entstanden ist. Aber selten ist die Entstehung minutiös dokumentiert, die Gedankengänge und Einfälle so dargelegt, dass sie eine Außen- und Nachwelt verstehen können. Und hier liegt eigentlich die größte Faszination in der Beschäftigung mit einem Meisterwerk, oder der Kunst selbst. Man kann die Biografien der Schöpfer aufarbeiten, deren Lebensumstände, deren Werdegänge darlegen, sie in dem Umfeld, in dem sie wirkten sowie der Zeit und der Gesellschaft, in der sie lebten kontextualisieren. Aber woher deren Kreativität und Ideen kamen, das ist auch heute noch eine ungemein interessante Frage – ganz besonders bei einem Komponisten wie Wolfgang Amadé Mozart.
„KOMPONIERT IST SCHON ALLES, ABER GESCHRIEBEN NOCH NICHT …“
Dieses Zitat ist ein schönes Beispiel dafür, wie man etwas aus seinem Zusammenhang reißt, um es mit einer anderen Bedeutung aufzuladen. Mozart, das war doch der Komponist, der alles im Kopf komponieren konnte und deswegen nie am Klavier saß, um etwas niederzuschreiben. Miloš Forman hat diesen Mythos – wie viele andere auch – in seinem Film Amadeus verfestigt: In einer Szene ist Mozart über einen Billardtisch in seiner Wohnung gebeugt und schreibt konzentriert auf einem Notenpapier. Gelegentlich rollt er eine Billardkugel über den Tisch. Man hört das Finale der Oper Le nozze di Figaro (Die Hochzeit des Figaro) was suggeriert, dass man gerade miterlebt, wie er komponiert. Als seine Frau Constanze eintritt und seine Aufmerksamkeit auf sich zieht, endet die Musik abrupt – die kreative Arbeit ist unterbrochen. So muss es doch gewesen sein, oder?
Die Wahrheit ist allerdings eine andere, denn der Schaffensprozess bei Mozart lässt sich, folgt man dem Musikwissenschaftler Ulrich Konrad, in vier Abschnitte unterteilen. Im ersten Abschnitt befasste Mozart sich mit einer Werkidee, studierte ähnliche Werke anderer Komponisten und improvisierte am Klavier. Im zweiten Schritt schrieb er seine eigenen Ideen nieder, meist verkürzt und skizzenhaft. Der dritte Schritt war die Niederschrift in einem Manuskript, einer „Entwurfspartitur“. War dieser Schritt vollendet, so hatte Mozart das Werk als „komponiert“ bezeichnet. In der vierten Phase ging es dann an die Erstellung einer fertigen Partitur. Als Mozart also 1780 in Bezug auf Idomeneo schrieb, es sei alles „komponiert“, war die Oper schon fertig niedergeschrieben, nur noch nicht im Sinne eines letzten Arbeitsschrittes ausgearbeitet.