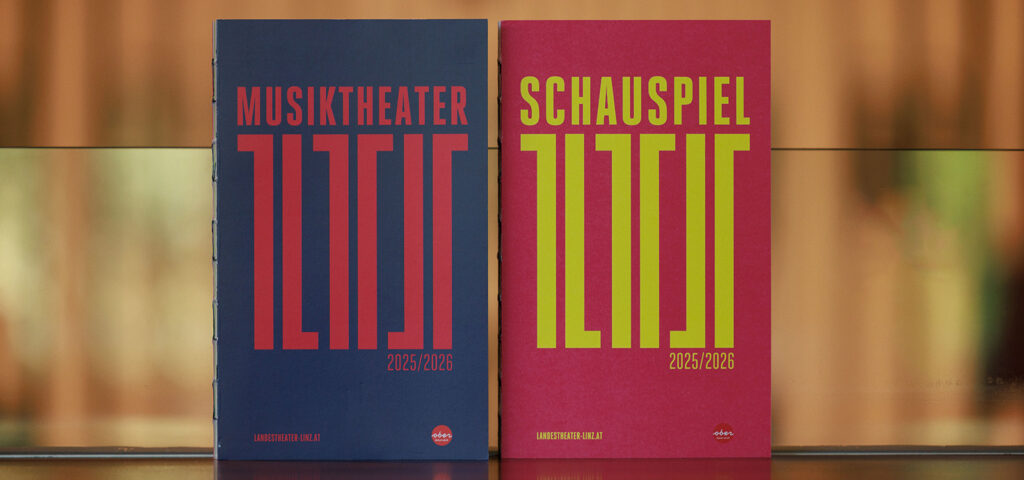Noch vor dreißig Jahren hätte ein Theater von der Größe des Schauspielhauses Graz oder des Schauspiels Linz normalerweise drei bis vier fest angestellte Regisseur*innen beschäftigt, die – gemeinsam mit einer regieführenden Direktorin, einem regieführenden Direktor – den größten Teil der Inszenierungen einer Saison bestritten hätten. Dieses Team von Hausregisseur*innen hätte in derselben Stadt gelebt und de facto eine weitere Abteilung des Theaters, nennen wir sie die „Regieabteilung“, dargestellt. (Nur dass drei oder mehr Regisseur*innen im selben Raum oder am selben Schauspielhaus sich nie als eine Abteilung sehen würden. Darum gibt es auch diesen Begriff nicht.) Bei der Entwicklung des Spielplans hätte die Direktorin, hätte der Direktor schon im Kopf gehabt, welche Regisseurin welches Stück inszeniert, und auch die Wege zur Verhandlung der Besetzungen waren entsprechend kurz.
Wenn drei oder vier Regisseur*innen zur selben Zeit jede ein Stück einstudieren (das ist der Normalbetrieb), gibt es zuvor notgedrungen Überschneidungen bei den Besetzungsvorstellungen. Dann kommt eine Schauspielerin oder ein Schauspieler für verschiedene Stückbesetzungen in Frage. Da aber jede Regisseurin im Laufe eines Jahres mehrere Inszenierungen besorgte, konnte „gedealt“ werden: Ein*e Regisseur*in macht zunächst ein großes (personenreiches) Stück, dafür inszeniert sie anschließend ein kleineres Stück (mit weniger Personen); bei dem ersten kann sie nicht alle ihre Lieblingsschauspieler*innen besetzen, dafür „bekommt“ sie bei dem zweiten nur ihre Wunschkandidaten. Auch neigte der Hausregie-Betrieb zur „Familienbildung“. Das heißt, bestimmte Schauspieler*innen gehörten zu bestimmten Regisseur*innen, so beantworteten bestimmte Fragen der Besetzung sich häufig von selbst: Wenn die Regisseur*in X „Die Jungfrau von Orleans“ – doch nein, sagen wir heute mal: „Die Glasmenagerie“ inszenierte, war zu 90 Prozent vorher klar, wer die Rollen darin spielen würde. Daraus ergab sich, dass die Spielpläne und die Besetzungen mehr oder weniger gleichzeitig entstehen konnten: Entschied sich eine Regisseurin, ein bestimmtes Stück zu inszenieren, verhandelte sie auch dessen Besetzung gleich mit der Theaterleitung – und mit der im Kopf konnten die Regisseurin und ihr Dramaturg sich daran machen, eine passende Stückfassung zu entwickeln.
Das alles war auch schon vor dreißig Jahren ein Haufen Arbeit. Die Verteilung der verschiedenen (gleichzeitig verschiedene Stücke einstudierenden) Besetzungen war durch die größere Nähe der Regisseur*innen zu den Theatern bzw. durch die Festanstellung dieser Regisseur*innen an den Theatern allerdings viel einfacher. Was hat sich geändert? Seit etwa 20 Jahren hat sich durchgesetzt, dass von den Regisseur*innen eines Sprechtheaters nur noch die Direktorin (wenn sie denn Regie führt) und allenfalls ihr „Oberspielleiter“ fest angestellt sind. Seit ca. zehn Jahren ist es an den meisten deutschsprachigen Häusern üblich, dass alle Regisseur*innen Gäste sind, das heißt: sie inszenieren nur ein oder zwei Stücke pro Saison an einem Haus, ihre anderen Regiearbeiten machen sie in anderen Städten und an anderen Theatern. Vielleicht kommen wir später dazu, über die Gründe für diese Veränderung nachzudenken (die liegen nämlich durchaus nicht auf der Hand). Da aber das ganze Sprechtheater deutscher Sprache gewissermaßen ein großes System ist, hat diese Veränderung, beginnend bei den großen Häusern, sich nach und nach bis zu den kleinen Häusern fortgepflanzt. Köln und Klagenfurt müssen sich die Regisseur*innen, ob sie wollen oder nicht, mit anderen Theater teilen, wenn die den Regisseur*innen verlockende Angebote machen und die Regisseur*innen diese nicht sausen lassen wollen. Und das hat Folgen für die Spielplanung, für die Arbeit an Besetzungen und an den Fassungen.
Schlägt ein Direktor einer Regisseurin ein Stück zur Inszenierung vor, muss die das Stück zunächst vielleicht erst einmal wieder lesen. Sollte sie sich dann für das Stück interessieren, will sie wissen, welche Schauspieler*innen sie dafür bekommen kann. Nun lebt die Regisseurin (heute) meist nicht dauerhaft in der Stadt, in welcher das Theater steht. Unter Umständen kennt sie – durch Veränderungen seit ihrem letzten Engagement – nicht alle Schauspieler, die zu diesem Zeitpunkt im Ensemble des Theaters engagiert sind. Die Regisseurin, der Regisseur kann also nicht ohne Weiteres die ganze Besetzung mit dem Direktor aushandeln, sondern muss sich einige Ensembleschauspieler in den Vorstellungen des Theaters zuerst ansehen. Auch muss der Regisseur, die Regisseurin – sollte es um einen Klassiker gehen – sich überlegen, wie viele Schauspieler*innen sie dafür überhaupt braucht. Auf der anderen Seite des Verhandlungstischs sitzt ein Direktor, der nicht mehr mit einem Kollektiv von drei oder vier Hausregisseur*innen, sondern mit 10 bis 15 Regisseur*innen (pro Saison) verhandelt, die alle noch nicht wissen, ob sie die ihnen vorgeschlagenen Stücke inszenieren wollen, wenn ja mit welchen Schauspieler*innen und mit wie vielen Personen insgesamt.
Das alles macht diese Verhandlungen – kurz und ungenau gesagt – komplizierter. Denn jede Besetzung hat in diesem Spiel Auswirkungen auf jede andere Besetzung. Alle Stücke werden ja aus einem Ensemble besetzt, und wenn eine Schauspielerin in der ersten Premiere der Saison besetzt ist, kann sie danach vielleicht erst wieder in der vierten oder fünften Premiere derselben Saison mit dabei sein – und so weiter. Die Verhandlung mit dem – im Vergleich zu früher – ungleich größeren Regiekollektiv (auch dieses Wort ist, wie „Regieabteilung“, ein Widerspruch in sich, ich weiß) braucht naturgemäß mehr Zeit, mit der Zeit wächst die Komplexität, da – siehe oben – die Besetzung des letzten Stückes einer Spielzeit womöglich die des ersten Stücks beeinflussen kann. Und darum können die Besetzungen an den meisten Stadttheatern heute vor der Drucklegung des Spielplanes erst in Eckpunkten festgelegt werden. In der Zwischenzeit (die manchmal bis kurz vor den Probenbeginn reicht) bleibt den Theaterleitungen und ihren Regisseur*innen nichts anderes übrig, als Planspiele zu machen. Und hier kommt – endlich – die Dramaturgie wieder ins Spiel.