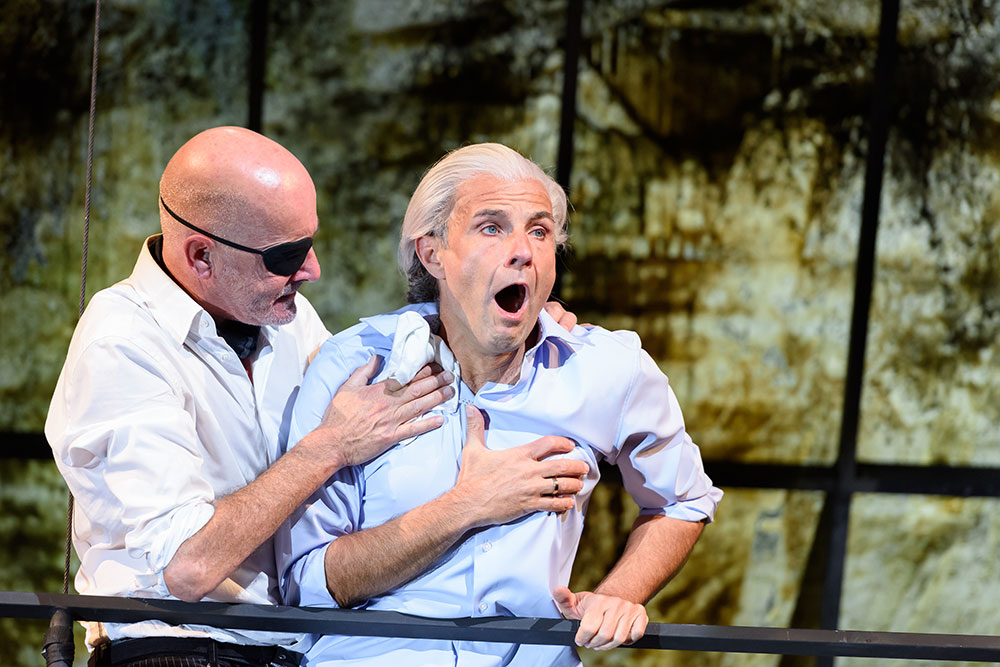Friedrich Nietzsche, einige Jahre jünger als Marx, kritisiert das Bürgertum der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und damit seine biedere Zurückgezogenheit. Es reicht nicht zur aristokratischen Größe und deshalb senkt es das eigene Anforderungsprofil nach unten ab. Dies führe zur „Selbstverzwergung“. Gerne nennt Nietzsche diesen Typus „Erdenfloh“ oder „der letzte Mensch“ – berühmt die Passagen aus seinem Zarathustra: „Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen. Die Erde ist klein geworden, und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der Alles klein macht. Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, dass die Unterhaltung nicht angreife. Man wird nicht mehr arm und reich. Wer will noch regieren? Wer noch gehorchen? Beides ist zu beschwerlich.“ Unschwer lässt sich hinter dieser Polemik die Figur des Gottlieb Biedermann erkennen. Dieser möchte ebenfalls behaglich leben, „seine Ruhe haben“ und der Obrigkeit gegenüber nicht unangenehm auffallen, indem er beispielsweise in Verdacht gerät, mit Brandstiftern zu tun zu haben.
Karl Marx hingegen sieht das Bürgertum ambivalenter. Zunächst erscheint es ihm als die folgerichtige Entwicklungsstufe einer anhaltenden Befreiungsgeschichte. Das Bürgertum sei in der Lage, die Erwerbsarbeit neu zu strukturieren und damit die feudal organisierte Aristokratie zu Fall zu bringen. Im Anschluss würde es sich mit der Arbeiterschaft verbünden und entscheidend zur klassenlosen Gesellschaft beitragen. Zu seiner Enttäuschung kam es aber anders. Anstatt sich mit der Arbeiterschaft zu solidarisieren, legen sich die Bürger mit der Aristokratie ins Bett. Zudem zeigt sich, dass der Wunsch, ebenfalls ein bürgerliches Leben zu führen, auf Seiten der Arbeiterschaft zu weiten Teilen die Revolutionsbestrebungen überwog. Marx verabschiedete sich deshalb von seiner Vorstellung, das Proletariat wäre das historisch-revolutionäre Subjekt. Rhetorisch überspitzt beschimpfte er abtrünnige Teile als „Lumpenproletariat“, also als Gauner, die den schnellen Weg des individuellen Reichtums suchen und nicht den beschwerlichen Weg zum Wohle aller auf sich nehmen wollen.